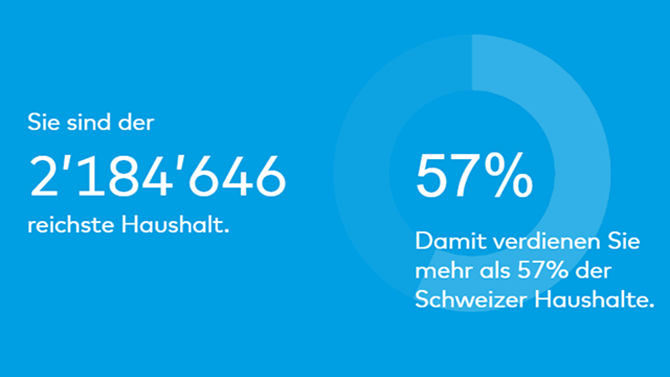Bei der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Entwicklung 2007−2020. Mit dem jetzt vorliegenden Jahr 2020 können wir erstmals die Einkommens- und Verteilungswirkungen des ersten Coronajahres berücksichtigen. Gerne hätten wir die Gegenwart stärker mitberücksichtigt, d.h. die Wirkungen aller Coronajahre, des Ukrainekriegs oder der Inflation auf die Einkommensentwicklung und -verteilung in der Schweiz untersucht. Allerdings liegen die notwendigen detaillierten Informationen immer erst vier Jahre später vor.
1 Summary
Einkommensentwicklung: Das Median-Haushaltseinkommen ist in der Schweiz zwischen 2007 und 2020 um insgesamt 9,8% gestiegen. Auch im Coronajahr 2020 erhöhte sich das Einkommen schweizweit im Vergleich zum Vorjahr.
In der Schweiz sind die Einkommen zwischen 2007 und 2020 spürbar gestiegen. Dies gilt sowohl für das Durchschnittseinkommen wie auch für das Medianeinkommen. Das mittlere Reineinkommen (Median) der Schweizer Haushalte beträgt rund 53 900 CHF. Im Beobachtungszeitraum ist dieses um 4 800 CHF angestiegen (+9,8% total, +0,7% pro Jahr). Das mittlere Reineinkommen ist im steuergünstigen Kanton Zug am höchsten und liegt dort bei 68 900 CHF (+14,5%). Als nächstes folgen im Ranking die Kantone Basel-Landschaft (60 100 CHF, +5,6%) und Zürich (59 900 CHF, +12,2%). Im Tessin (44 550 CHF, +0,1%) und im Wallis (44 950 CHF, +16,8%) zeigen sich die geringsten mittleren Reineinkommen.
Die Coronakrise hat schweizweit zu keinem Rückgang der Einkommen geführt. Trotz des Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivitäten im Jahr 2020, haben sich dank staatlicher Stützungsmassnahmen und eines robusten Arbeitsmarktes, die Einkommen im Schweizer Durchschnitt positiv entwickelt. Die Spuren der Krise waren aber in den Kantonen unterschiedlich stark. Während einige Kantone insbesondere das Wallis ihr Einkommen deutlich steigern konnte, mussten andere rückläufige Einkommen hinnehmen. Am stärksten negativ betroffen waren die Einkommen im Kanton Schwyz.
Einkommensverteilung: Grosse Unterschiede im kantonalen Vergleich. Der Kanton Wallis holt auf.
Im kantonalen Vergleich zeigen sich grössere Unterschiede: Die Reineinkommen der obersten 10% der Haushalte reicht von mindestens 107 800 CHF im Kanton Wallis bis mindestens 201 800 CHF im Kanton Zug (Schweiz: 131 400 CHF). Damit liegt dieser Wert in der ganzen Schweiz bei über 100 000 CHF. Die Hälfte aller Haushalte im Kanton Zug hat ein Einkommen von mehr als 68 900 CHF, womit Zug auch bei diesem Wert an der Spitze des Rankings liegt. Hingegen verdient im Kanton Wallis die Hälfte aller Haushalte weniger als 44 950 CHF, im Kanton Tessin weniger als 44 550 CHF.
Während aber 2019 der Kanton Wallis beim mittleren Einkommen noch das Schlusslicht bildete, war es 2020 das Tessin. Dies liegt daran, dass das Wallis auch im Coronajahr 2020 eine Erhöhung des mittleren Reineinkommens verbuchen konnte, während das Tessin einen leichten Rückgang erfuhr. Insgesamt stagnierten die mittleren Einkommen im Tessin nahezu zwischen 2007 und 2020 (+0,1%). Der Kanton Wallis konnte hingegen sein mittleres Einkommen um 16,8% steigern und dadurch mit am stärksten von allen Kantonen. Lediglich im Kanton Obwalden erhöhte sich das mittlere Einkommen zwischen 2007 und 2020 von 45 700 CHF auf 54 200 CHF noch stärker (+18,6%).
2 Einkommensentwicklung
In diesem Kapitel wird die Entwicklung des Haushaltseinkommens im Laufe der Zeit betrachtet. In der Tat umfasst das Einkommen eines Haushaltes mehr als nur Löhne. Es können ebenso Renten, Mieteinnahmen und andere Kapitalerträge dazu gehören. Aus diesen ungleichen Einkommensquellen können sich zahlreiche unterschiedliche Definitionen des «Einkommens» ergeben, die in verschiedenen Statistiken erhoben werden. Für einen Vergleich ist es zentral, die Definition zu kennen und eine einheitliche Definition zu verwenden.
Im Bank Cler Swiss Income Monitor BCSIM werden als «Einkommen» die Reineinkommen der Steuerstatistik betrachtet. Das Reineinkommen ergibt sich, wenn man vom steuerpflichtigen Bruttoeinkommen (Löhne, Renten, erhaltene Alimente sowie Kapital- und Mieterträge) die steuerlich relevanten Aufwendungen (wie ausserordentliche Sozialversicherungsbeiträge, gegebene Alimente, Einzahlung 3. Säule und Schuldzinsen (z.B. Hypothekarzinsen)) und die allgemeinen Abzüge (wie z. B. Krankheitskosten oder Aufwendungen für Aus- und Weiterbildungen) abzieht. Diese Einkommensdefinition eignet sich besonders gut für einen gesamtschweizerischen Vergleich, da einheitliche und umfassende Daten für alle Kantone zur Verfügung stehen, was auch die Analyse spezifischer Veränderungen im Zeitablauf (z.B. Steuerreformen) ermöglicht. Darüber hinaus berücksichtigt dieses Einkommenskonzept alle Einkommensquellen und trägt der Lebenswirklichkeit des «gewöhnlichen» Haushaltseinkommens Rechnung.
Anstieg der Einkommen in der Schweiz
Wie viel «verdient» eigentlich ein Schweizer Haushalt im Durchschnitt? Im Jahr 2020 wurden gut 71 000 CHF verdient. Zwischen 2007 und 2020 stieg das durchschnittliche Reineinkommen um fast 7 900 CHF an; das entspricht einer Erhöhung von insgesamt 12,5%. Im Schnitt entspricht dies einem Einkommenszuwachs von 600 CHF pro Jahr. Fokussiert man auf die einzelnen Jahre, so zeigt sich die Auswirkung der Finanzkrise lediglich in einer Abschwächung der Wachstumsdynamik in den Jahren 2009 und 2010. Das Schweizer Durchschnittseinkommen ist in allen Jahren ausser 2012 und 2015 angestiegen. Auch zwischen 2019 und 2020 sind die Durchschnittseinkommen um fast 1% gestiegen. Die COVID-19 Pandemie hat damit schweizweit nicht zu einem Einkommensrückgang geführt.

Haushaltseinkommen in CHF, Wachstumsrate in %
Quelle: ESTV, BAK Economics
Generell kann man festhalten, dass sowohl das Durchschnittseinkommen (+0,9% pro Jahr) wie auch das Median-Einkommen (+0,7% pro Jahr) in der Schweiz im Beobachtungszeitraum von 2007 bis 2020 in ähnlichem Umfang angestiegen sind. Auch zwischen 2019 und 2020 haben sowohl das Durchschnitts- als auch das Medianeinkommen zugenommen. Trotz des Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivitäten im Jahr 2020, haben sich dank staatlicher Stützungsmassnahmen und eines robusten Arbeitsmarktes, die Einkommen im Schweizer Durchschnitt positiv entwickelt.
Entwicklung des Medianeinkommens
Medianreineinkommen in CHF
Quelle: ESTV, BAK Economics
Haben die Einkommen auch real zugenommen? Wenn die Preise stärker steigen als die Einkommen, könnte es durch Inflation dazukommen, dass die Einkommen zwar nominal zugenommen haben, aber die Kaufkraft, also die Menge der Güter, die ein Haushalt für das Einkommen kaufen kann, abgenommen hat. Zwischen 2007 und 2020 sind – mit Ausnahme des Jahres 2008 – die mittleren Reineinkommen immer stärker gestiegen als die Preise (gemessen am Landesindex für Konsumentenpreise 2005=100, https://www.bfs.admin.ch/asset/de/cc-d-05.02.08, Zugriff: 29.04.2024). Zwischen 2007 und 2020 sind die Preise meist nur moderat gestiegen, in einigen Jahren - wie auch im Jahr 2020 – waren die Preise sogar rückläufig (Deflation). In der Folge hat sich das mittlere Reinkommen im Beobachtungszeitraum real um 8% (4 000 CHF) auf 53 100 (in Preisen von 2007) erhöht. Zwischen 2019 und 2020 erhöhte sich das Einkommen unter Berücksichtigung der Deflation real um 1,2% bzw. 650 CHF.
Steuergünstiger Kanton Zug zeigt die höchsten Einkommen
In welchen Kantonen sind die Einwohner finanziell gut gestellt? Und wo müssen sie sich mit weniger zufrieden geben? Betrachtet man die einzelnen Kantone, so liegen die steuergünstigen Kantone Zug, Schwyz und Nidwalden an der Spitze des Rankings der Durchschnittseinkommen. Der Kanton Zug zeigt mit rund 115 300 CHF das höchste kantonale Durchschnittseinkommen. Damit liegt Zug etwa 44 300 CHF höher als der Gesamtschweizer Durchschnitt. Im Kanton Schwyz verdienen die Haushalte im Schnitt rund 96 200 CHF. Nach Zug und Schwyz folgen die Kantone Nidwalden (85 400 CHF), Zürich (80 300 CHF), Obwalden (78 000 CHF) und Genf (76 800 CHF), wobei Zürich und Genf nicht zu den steuergünstigsten Kantonen zählen. Die Steuerbelastung ist also nicht der einzige Faktor, der die Unterschiede erklärt. Eine weitere Ursache für die hohen Einkommen dieser Kantone findet sich in der Branchenstruktur. In Zürich ist es der ausgesprochen grosse Finanzsektor, welcher mit hohen Löhnen und grossen Boni die Einkommen nach oben treibt. Zudem sind im Kanton Zürich viele Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfer niedergelassen. Auch in dieser Branche sind die Einkommen überdurchschnittlich hoch. Genf verfügt ebenfalls über einen grossen Finanzsektor und zusätzlich über den Rohstoffhandel, wo die Einkommen hoch sind.
Am unteren Ende des Rankings befinden sich die Kantone Jura und Wallis mit einem Durchschnittseinkommen von 54 700 CHF und 54 100 CHF. Auch in diesen Kantonen lässt sich das tiefe Einkommensniveau unter anderem mit der Branchenstruktur erklären. In beiden Kantonen sind die Hochlohnbranchen untervertreten und die Wirtschaftsbereiche mit eher tieferen Einkommen dafür relativ stark. Im Kanton Wallis sind beispielsweise 9% der Beschäftigten im Gastgewerbe tätig, während dieser Anteil im Schweizer Durchschnitt bei lediglich 4% liegt. Auch im Kanton Jura ist ein grosser Anteil der Beschäftigung in Branchen mit niedrigeren Einkommen tätig. 32% der Beschäftigung sind im verarbeitenden Gewerbe des Kantons angesiedelt. Dazu gehören aber auch die Pharma- und die Uhrenindustrie, zwei Sektoren, die ein hohes Produktivitäts- und generell ein gutes Lohnniveau aufweisen. Betrachtet man die ganze Schweiz, arbeiten nur 15% aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe.
Kanton Obwalden holt im Beobachtungszeitraum am stärksten auf, gefolgt von Basel-Stadt
In zwei Kantonen ist das Durchschnittseinkommen zwischen 2007 und 2020 um mehr als 20% gestiegen (Schweiz: +12,5%): Im Kanton Obwalden um 34% und in Basel-Stadt um fast 23%. Dagegen nahm das Durchschnittseinkommen in Genf ab (-1,3%).
Um die Verzerrung durch einzelne Spitzenverdiener auszublenden (die den Mittelwert vor allem in kleineren Kantonen stark beeinflussen können), wird auch noch das Median-Einkommen betrachtet. Das Medianeinkommen ist ebenfalls im steuergünstigen Kanton Zug am höchsten und liegt dort bei 68 900 CHF. Als nächstes folgen im Ranking die Kantone Basel-Landschaft (60 100 CHF) und Zürich (59 900 CHF). Im Tessin (44 550 CHF) und im Wallis (44 950 CHF) zeigen sich die tiefsten Medianeinkommen. Im Kanton Tessin ist die enge Verflechtung mit dem Grossraum Mailand unter anderem ein Einflussfaktor für die tiefen Einkommen. Mit der Nähe zum Euroraum ist der Druck auf die Preise und somit die Einkommen wesentlich höher als im Schweizer Durchschnitt. Mehr als 25% der Beschäftigten im Kanton Tessin sind Grenzgänger, die deutlich tiefere Lohnansprüche haben dürften als die Schweizer Arbeitnehmer.
In sieben Kantonen ist der Median über die Beobachtungszeit um die 14% und mehr gewachsen: In Obwalden um nahezu 19%, im Wallis und Uri um fast 17%, in Zug an die 15%, und in Appenzell Innerrhoden, Bern und Thurgau um die 14% (Schweiz: +9,8%). Der Kanton Obwalden konnte sowohl bei den Durchschnittseinkommen wie auch bei den Medianeinkommen am stärksten aufholen. Lediglich in Genf ist das Medianeinkommen im Beobachtungszeitraum – wie auch das Durchschnittseinkommen – gesunken (-1,2% bzw. -4,4%).
Corona führt zu unterschiedlichen Einkommensentwicklungen in den Kantonen: Wallis stärksten Einkommensanstieg, Schwyz höchste Einbussen
Die Durchschnittseinkommen haben schweizweit zwischen 2019 und 2020 leicht zugenommen. In den Kantonen verlief aber die Entwicklung sehr unterschiedlich: Die Durchschnittseinkommen sind im Kanton Wallis von 51 400 CHF auf 54 100 CHF (5,3%) gestiegen. Auch das Durchschnittseinkommen im Kanton Bern hat zugenommen (1,1%); ebenso in Graubünden und Basel-Stadt (jeweils 0,6%) und in Schaffhausen (0,2%). Die anderen Kantone waren mit Rückgängen des Durchschnittseinkommens konfrontiert. Das Durchschnittseinkommen sank am stärksten in den Kantonen Schwyz (-6,0%) und Nidwalden (-5,2%).
Das Medianeinkommen, das weniger von Ausreissern bestimmt ist, erhöhte sich im Schweizer Durchschnitt ebenfalls zwischen 2019 und 2020, wenngleich etwas weniger stark als das Durchschnittseinkommen (+0,9% versus +0,6%). Das Medianeinkommen erhöhte sich in den meisten Kantonen. Die Kantone Wallis (+6,0%), Bern (+1,6%), Basel-Stadt (+1,5%) und Obwalden (+1,1) konnten Zuwächse von mehr als einem Prozent, trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen des Jahres 2020 gegenüber dem Jahr 2019, verbuchen. Das Medianeinkommen stagnierte in den Kantonen Appenzell-Ausserrhoden, Jura, Thurgau, Uri und Waadt. Rückläufige mittlere Einkommen im Coronajahr zum Vorjahr mussten die Kantone Schwyz (-1,7%), Glarus (-0,9%), Genf und Neuenburg (jeweils -0,4%) sowie das Tessin (-0,1%) hinnehmen.
Fazit Einkommensentwicklung
In der Schweiz sind die Einkommen zwischen 2007 und 2020 spürbar gestiegen. Dies gilt sowohl für das Durchschnittseinkommen wie auch für das Medianeinkommen. Von den Schweizer Kantonen zeigt der Kanton Zug das höchste Durchschnitts- und Medianeinkommen. Am anderen Ende des Rankings steht das Wallis mit dem tiefsten Durchschnittseinkommen und das Tessin mit dem tiefsten Medianeinkommen. Der Kanton Obwalden konnte sowohl bei den Durchschnittseinkommen wie auch bei den Medianeinkommen am stärksten aufholen. Einzig im Kanton Genf waren die Einkommen über den Beobachtungszeitraum rückläufig. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht zwingend bedeutet, dass die Einkommen individueller Haushalte im Schnitt gefallen sind. Es kann auch die Auswirkung einer Verschiebung von Haushaltsstrukturen sein; wenn beispielsweise gutverdienende Haushalte verstärkt den Kanton Genf verlassen haben.
Die Coronakrise hat schweizweit zu keinem Rückgang der Einkommen geführt. Die Spuren der Krise waren aber in den Kantonen unterschiedlich stark. Während einige Kantone insbesondere das Wallis ihr Einkommen deutlich steigern konnte, mussten andere rückläufige Einkommen hinnehmen. Am stärksten negativ betroffen waren die Einkommen im Kanton Schwyz.
3 Einkommensverteilung
Wie sind die Reineinkommen in der Schweiz verteilt? Die folgende Grafik zeigt alle Einkommen der Schweizer Haushalte in Perzentile, die sogenannte Pen Parade im Jahr 2020. Diese unterteilen einen nach der Grösse geordneten Datensatz in hundert Teile. Die Einkommensverteilung umfasst das gesamte Einkommensspektrum einer Bevölkerung (von den niedrigsten bis zu den höchsten).
Einkommensverteilung Schweiz

10% der Haushalte verdienen mehr als 131 400 CHF – 50% der Haushalte verdienen weniger als 53 900 CHF
Die Grafik wird folgendermassen interpretiert: Das 10. Perzentil (dargestellt durch die 10. Säule von links) gibt beispielsweise die Einkommenshöhe an, die von 10% der Haushalte nicht überschritten wird. Das 50. Perzentil entspricht dem Median-Einkommen.
Die unteren 10% der Haushalte in der Schweiz überschreiten ein Einkommen von 6 300 CHF nicht. Dies umfasst u.a. auch volljährige SchülerInnen, Lernende und Studierende, die von ihren Eltern unterstützt werden. Dieser Wert lag damit 2020 um 400 CHF höher als im Jahr 2019. Die oberen 10% der Haushalte haben ein Jahreseinkommen von mehr als 131 400 CHF im Jahr 2020 und damit um 300 CHF mehr als im Jahr 2019. Wie bereits das Median-Einkommen zeigt, hat die eine Hälfte aller Haushalte in der Schweiz ein Reineinkommen von mehr als 53 900 CHF, die andere Hälfte weniger als 53 900 CHF. Das Median-Einkommen hat, wie oben erwähnt, schweizweit zwischen 2019 und 2020 nicht abgenommen, sondern ist um 300 CHF gestiegen. Insgesamt zeigt sich die Verteilung der Haushaltsreineinkommen trotz Krise sehr stabil. In allen Perzentilen kam es im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zu Einkommenssteigerungen mit Ausnahme der obersten 3 Prozent, die Einkommensverluste erlitten.
In allen Kantonen verdienen die obersten 10% der Haushalte mehr als 100 000 CHF
Wie sieht die Verteilung der Einkommen in den Kantonen aus? Die Reineinkommen der obersten 10% der Haushalte reicht von mindestens 107 800 CHF im Kanton Wallis bis mindestens 201 800 CHF im Kanton Zug (Schweiz: 131 400 CHF). Damit lag dieser Wert in der ganzen Schweiz bei über 100 000 CHF.
Das mittlere Reineinkommen ist im steuergünstigen Kanton Zug am höchsten und liegt dort bei 68 900 CHF (+14,5%). Als nächstes folgen im Ranking die Kantone Basel-Landschaft (60 100 CHF, +5,6%) und Zürich (59 900 CHF, 12,2%). Im Tessin (44 550 CHF, +0,1%) und im Wallis (44 950 CHF, +16,8%) zeigen sich die geringsten mittleren Reineinkommen. Die Kantone mit den höchsten mittleren Einkommen waren 2019 wie auch 2020 die Kantone Zug, Basel-Landschaft und Zürich. Das Wallis und das Tessin waren die beiden Kantone mit den geringsten mittleren Reineinkommen. Während aber 2019 der Kanton Wallis das Schlusslicht bildetet, war es 2020 das Tessin. Dies liegt daran, dass das Wallis auch im Coronajahr 2020 eine Erhöhung des mittleren Reineinkommens verbuchen konnte, während das Tessin einen leichten Rückgang erfuhr. Während das Tessin zwischen 2007 und 2020 mehr oder weniger eine Stagnation des mittleren Einkommens hinnehmen musste (+0,1%), konnte der Kanton Wallis sein mittleres Einkommen um 16,8% steigern und damit am stärksten von allen Kantonen. Lediglich im Kanton Obwalden erhöhte sich das mittlere Einkommen zwischen 2007 und 2020 von 45 700 CHF auf 54 200 CHF noch stärker (+18,6%).

Haushaltseinkommen in CHF, Wachstumsrate in %
Quelle: ESTV, BAK Economics
10% der Haushalte verdienen mehr als ein Drittel des Gesamteinkommens
Betrachtet man bei der Einkommensverteilung nicht die Einkommensgrenzen, sondern die Anteile am Gesamteinkommen, so verdienen in der Schweiz die untersten 10% der Haushalte rund 0,4% des Gesamteinkommens. 50% aller Haushalte erhalten 17% des gesamten Einkommens, für 90% der Haushalte beträgt dieser Wert 59% des Einkommens. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass weit mehr als ein Drittel (41%) des Gesamteinkommens von den obersten 10% der Haushalte generiert wird.
Anteil reicht von 30% im Kanton Uri bis zu 59% im Kanton Schwyz
Kantonal unterscheiden sich die Anteile der verschiedenen Haushaltsgruppen am gesamten Einkommenskuchen erheblich. Die Hälfte aller Haushalte ist im Kanton Uri für 23% des gesamten Einkommens verantwortlich – dies ist der höchste Wert aller Kantone. In Genf zeigt sich abermals der geringste Anteil mit lediglich 10%.
90% der Haushalte erhalten wiederum in Uri den höchsten Anteil am Gesamteinkommen (etwa 70%) und in Schwyz den niedrigsten (41%). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in Uri 30% des Gesamteinkommens von den obersten 10% der Haushalte generiert wird, in Schwyz dagegen hohe 59%.
Einkommensverteilung – Fazit
Die Hälfte aller Haushalte der Schweiz ist für lediglich 17% des gesamten Einkommens verantwortlich. Die obersten 10% generieren 41% des Gesamteinkommens. Bei der kantonalen Betrachtung zeigte sich die Hälfte aller Haushalte im Kanton Uri für 23% des gesamten Einkommens verantwortlich und damit für so viel wie in keinem anderen Kanton. Die obersten 10% haben in Uri mit 30% des Gesamteinkommens den geringsten Anteil aller Kantone, in Schwyz mit 59% den höchsten.
4 Exkurs: Vermögen
Immer mehr Vermögensmillionäre
Die Anzahl der Vermögensmillionäre stieg zwischen 2007 und 2020 um beachtliche 72% auf mehr als 374 000 Haushalte (9,7% aller Schweizer Haushalte). Dieser Anstieg lässt sich allein weder durch die Teuerung (die praktisch null betrug) noch durch Migration erklären. Während der Börseneinbruch anlässlich der Finanzkrise im Jahr 2008 sichtbar ist, haben die wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronakrise keine Auswirkungen gezeigt. Die Anzahl der Vermögensmillionäre hat auch im Coronajahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 000 Personen zugenommen. Während im ersten Quartal 2020 die COVID-19 Pandemie die globalen Finanzmärkte kurzfristig stark beeinträchtigte, setzten die Aktienkurse in der zweiten Jahreshälfte ihren Aufwärtstrend fort und erreichten teilweise zum Jahresende Rekordwerte. Auch Häuserpreise stiegen deutlich. Insbesondere Aktienvermögen und Immobilienbesitzer konnten von den steigenden Preisen profitieren.
Der höchste Anteil der Vermögensmillionäre im Verhältnis zur Zahl der Steuerpflichtigen befindet sich im Kanton Zug (14,8%), gefolgt von Schwyz (13,7%), Appenzell-Innerrhoden (12,3%), Nidwalden (11%) und Zürich (9,7%).
Vermögensmillionäre

Anzahl in Personen
Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung, Statistik über die kantonalen und gesamtschweizerischen Vermögensverhältnisse der natürlichen Personen
Vermögen der Millionäre

In Mio. CHF
Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung, Statistik über die kantonalen und gesamtschweizerischen Vermögensverhältnisse der natürlichen Personen
Der Vermögensaufbau der privaten Haushalte setzte sich im Pandemiejahr 2020 fort. Das Gesamtvermögen erhöhte sich ähnlich wie im Durchschnitt der Jahre zwischen 2007 und 2020 um 3,9%, die Forderungen um 3,2% und die Immobilienvermögen stiegen um 4,4%. Auch das Reinvermögen der privaten Haushalte erhöhte sich zwischen 2019 und 2020 um 4%. Die wirtschaftlichen Verwerfungen des ersten COVID-Jahres 2020 führten damit nicht zu einem Vermögensverzehr der privaten Haushalte zur Krisenbewältigung. Im gesamten Betrachtungszeitraum fand nur im Jahr der Finanzkrise 2008 im Total ein Vermögensabbau statt.
Vermögen privater Haushalte

In Mio. CHF
Quelle: Schweizerische Nationalbank, Vermögen privater Haushalte
Vermögensverteilung – Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aufgrund der in der Periode 2007 bis 2020 insgesamt deutlich angestiegenen Immobilien- und Börsenwerte die Vermögen in der Schweiz wesentlich stärker zugenommen haben als die Einkommen oder das BIP. Entsprechend sind auch die Anzahl der Vermögensmillionäre und deren Vermögen sehr deutlich angestiegen. Die Corona-Krise hat zwar zu einem kurzfristigen Rückgang des BIPs (-2,8%) geführt, die Vermögensentwicklung war aber davon nicht betroffen. Die Schweizer konnten weiter Vermögen aufgrund der gestiegenen Immobilien- und Börsenwerte aufbauen und waren dank staatlicher Stützungsmassnahmen nicht zu einem Vermögensverzehr gezwungen.
Die wichtigen Fragen fürs Verständnis
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und die wichtigsten Definitionen finden Sie hier.